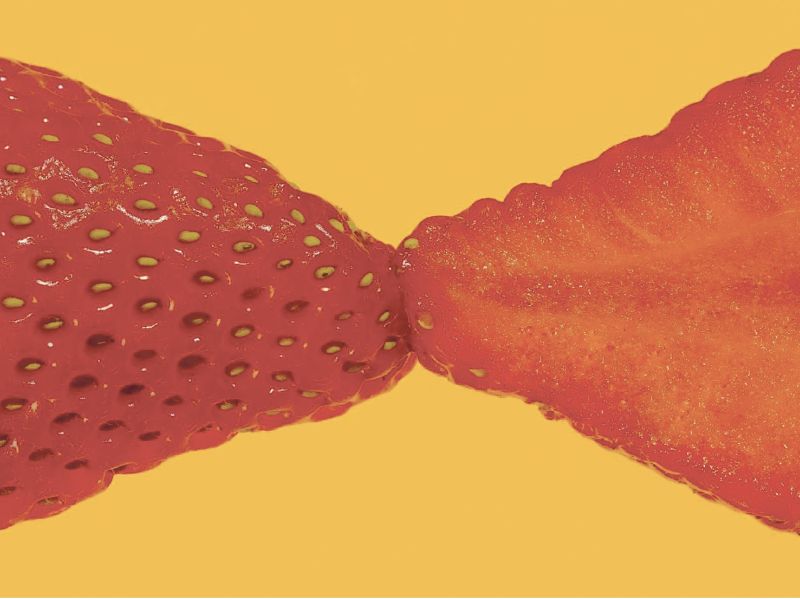Orte vieler Ansprüche
Gemeindeleben • Öffentliche Räume sind für alle da. Oder sie sollten für alle da sein. Doch das zu erreichen, ist nicht so einfach.

Drei Kinder spielen gemeinsam auf dem Spielplatz neben dem Schulhaus. Ein paar Jugendliche verbessern ihre Skateboard-Fähigkeiten im Skatepark. Ein Mann wartet an der Busstation auf den Bus. Eine Frau fährt mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse zur Arbeit. Ein Ehepaar spaziert abends der Aare entlang.
Diese und viele weitere Situationen haben etwas gemeinsam: Sie finden in öffentlichen Räumen statt. Wir alle sind auf öffentliche Räume angewiesen, weshalb diese aus gesellschaftlicher Sicht eine grosse Bedeutung tragen.
Komplizierter Begriff
Was genau alles unter den Begriff «öffentlicher Raum» fällt, lässt sich indes nicht so leicht beantworten. Wie das Zentrum Öffentlicher Raum (ZORA) in einem Einführungstext schreibt, ändert sich die Nutzung ein und desselben ÖR im Laufe der Zeit möglicherweise.
Das ZORA nennt verschiedene Definitionen. Erstens kann der Begriff ÖR Räume des öffentlichen Eigentums bezeichnen, die entsprechend auch von der öffentlichen Verwaltung gepflegt, kontrolliert und verantwortet werden. Zweitens können auch Flächen zu ÖR zählen, die alle nutzen können. Und das unabhängig davon, wem die Fläche gehört. Sie muss jedoch frei zugänglich sein. Drittens bezieht sich der Begriff ÖR manchmal auf zentrale Bereiche einer Gemeinde, wie beispielsweise Fussgängerzonen, Passagen, Plätze, Parks oder Seeufer. Viertens gilt es bei der Bestimmung ÖR zu beachten, dass deren unbedingte Zugänglichkeit nicht immer gegeben sein muss. Man denke hierbei an Einkaufszentren, die nachts geschlossen sind, oder Schulgelände, die für Schüler und Lehrpersonen gedacht sind. Auch Strassen gelten häufig als ÖR, obschon diese eben nicht unbedingt zugänglich sind. So dürfen Fussgänger auf gewissen Strassen nicht herumspazieren, sondern müssen das Trottoir benutzen.
Grundsätzlich gelten gemäss ZORA als öffentliche Räume in der Regel ohne besondere Befugnisse oder wesentliche Beschränkungen zugängliche und nutzbare Plätze, Parks, Strassen, Wege und dergleichen. Häufig spricht man deshalb auch von öffentlich nutzbaren Räumen.
Chancen und Herausforderungen
Wie das ZORA schreibt, sind ÖR für Gemeinden und Städte aus mehreren Gründen von grosser Bedeutung. Ein Grund liegt in ihrer Erlebbarkeit. ÖR ermöglichen kollektive und individuelle Erlebnisse wie beispielsweise Dorffeste. Ein weiterer Grund liegt in der ästhetischen Qualität. So können Marktplätze oder Parks das Dorf- oder Stadtbild insgesamt positiv prägen. Einen dritten Grund stellt die Nutzbarkeit dar. Öffentliche Räume erfüllen verschiedene Nutzungsansprüche. Sie können zum Beispiel als Ort der Begegnung oder Ruhe dienen.
Vor allem bieten ÖR auch die Möglichkeit, Vielfalt zu erleben – und damit auch Kommunikation und Sozialisation. Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, lernt Fremdes und Fremde kennen. Je nachdem verlangt das vom ein oder anderen, Andersartigkeit auszuhalten. Im Extremfall entwickelt sich ein ÖR zu einem Raum der Bedrohung, Unsicherheit und Ausgrenzung.
Eine Frage des Alters
Eine weitere Herausforderung ergibt sich für die Planung öffentlicher Räume hinsichtlich der demografischen Ausgangslage. Die Organisation Intergeneration fördert die Generationenbeziehungen in der Schweiz. In einem Text auf ihrer Webseite stellt sie die These auf, dass ÖR nicht für alle gleich zugänglich und nutzbar sind. Vor allem vulnerable Altersgruppen wie ältere Menschen, Kinder und Jugendliche stehen aufgrund ihres Alters vor Hindernissen, Beeinträchtigungen und Ausgrenzungen.
So stellen beispielsweise komplexe Verkehrssituationen, grosse Gehdistanzen zu Grünanlagen oder unebene und beschädigte Gehwege grosse Probleme dar. Sind ÖR für ältere Menschen nicht gut zugänglich, bleiben sie eher zu Hause und reduzieren dementsprechend ihre Aktivitäten ausserhalb der Wohnung auf das Notwendigste. Dieses Verhalten begünstigt einen sozialen Rückzug und eine eingeschränkte körperliche Betätigung. Dass daraus gesundheitliche Probleme resultieren, erklärt sich von selbst. Bereits Ruhebänke und -zonen und langsamere Fussgängerampeln können eine grosse Erleichterung darstellen. Und aufgrund der Klimaerhitzung verschärft sich das Problem der Hitzeinseln. Diese gefährden vor allem die Gesundheit älterer und jüngerer Menschen. Deshalb kommt Intergeneration zum Schluss, dass es eine generationenübergreifende und inklusive Stadtplanung braucht, damit ÖR von allen genutzt werden können.
Eine Frage des Geschlechts
Wie das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) in einem Bericht aus dem Jahr 2022 zeigt, ist die Nutzung des ÖR in der Praxis bei vielen Menschen mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Das SKMR verweist auf Studien und deren Ergebnisse. Erstens fühlen sich Männer im ÖR signifikant sicherer als Frauen (88 zu 77 Prozent). Zweitens geben viele Frauen zwischen 16 und 25 an, im ÖR bereits belästigt worden zu sein. Bezogen auf Gewalt sind Frauen drittens mehr von sexualisierter Gewalt betroffen als Männer. Männer hingegen erleiden mehr nicht sexualisierte Gewalt. Und grundsätzlich hat die Gewalt an Frauen zwischen 15 und 24 Jahren im ÖR zwischen 1995 und 2014 um 181 Prozent zugenommen.
Das Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern verfasste 2018 einen Bericht mit einer systematischen Übersicht über bestehende Massnahmen gegen sexistische Belästigung im öffentlichen Raum und im Nachtleben in Schweizer sowie europäischen Städten.
Der Bericht kommt zum Schluss, dass verschiedene Städte auf Prävention, Sensibilisierung und Ausbildung setzen, um sexistische Belästigung im ÖR zu verringern. Vor allem Sensibilisierungskampagnen und Weiterbildungen zum Thema Sexismus und Belästigung sollen Abhilfe schaffen. Bezogen auf die Schweiz verweist der Bericht auch auf den Lehrplan21. Auch in diesem ist der Abbau von Stereotypen und eine entsprechende Sensibilisierung verankert. Und als konkrete bauliche Massnahmen verweist der Text auf Bewährtes wie Frauenparkplätze oder die Aufwertung dunkler Unterführungen. Um künftig noch gezielter Massnahmen gegen Sexismus und Belästigung umsetzen zu können, ist es laut dem Bericht wichtig, genügend Frauen in die Stadt-, Quartier- oder Gemeindeplanung zu involvieren.
Im Wandel der Zeit
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei einem Blick in die Vergangenheit. Gerade während der industriellen Revolution standen sich der öffentliche Raum als Domäne für Männer und das Private als Domäne der Frauen gegenüber. «Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sorgte dafür, dass sich Männer im öffentlichen Raum bewegten, um für ihr Gehalt zu arbeiten», erklärt Carolin Schurr, Professorin für Sozial- und Kulturgeografie an der Universität Bern, «Frauen wiederum verrichteten zu Hause Reproduktionsarbeit.» Und da Frauen allgemein als emotional, instabil und schwach dargestellt wurden, seien sie in den öffentlichen Räumen nicht erwünscht gewesen. Obschon diese Trennung heute nicht mehr so deutlich ist, wirke sie sich, je nach kulturellem Kontext, immer noch aus.
Geschlechterunabhängig dienten öffentliche Bereiche während des Römischen Reichs zur Unterhaltung der städtischen Bevölkerung. Bekannte Beispiele sind Wagenrennen, Theateraufführungen, öffentliche Hinrichtungen, Jagden auf wilde Tiere, vorgetäuschte Seeschlachten und Gladiatorenkämpfe.
Die langen und breiten Boulevards in Paris, die sich heute grosser Bedeutung erfreuen, stammen aus dem
19. Jahrhundert. Damals sprengte Napoleons Präfekt, Georges Haussmann, die überfüllten Räume des mittelalterlichen Paris.
Und in vielen amerikanischen Grossstädten wurden im späten 20. Jahrhundert ganze Stadtviertel abgerissen. Im Gegenzug entstanden Autobahnen, Parks und andere Einrichtungen für die öffentliche Nutzung.
Nachhaltige Entwicklung
Heute stehen Stadtplaner vor grossen Herausforderungen. «Um ökologischen, sozialen und ökonomischen Ansprüchen zu genügen, ist ein Phasing-out des bisher dominanten, nicht nachhaltigen Entwicklungspfades erforderlich», sagt Schurr. Das bedeutet beispielsweise, dass bestehende Infrastrukturen nach und nach den Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung angepasst werden müssen. Doch «das Phasing-out kommt nicht automatisch», so Schurr, «es ist aktiv durch politische und zivilgesellschaftliche Akteure voranzubringen.»
Aber es geht nicht nur darum, veraltete Strukturen anzupassen. Genauso wichtig sei es gemäss Schurr, «das Phasing-in in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung aktiv voranzutreiben». Darunter sind beispielsweise erneuerbare Energien, eine erhöhte Raumeffizienz und Barrierefreiheit zu verstehen.