Wenn das Fleisch im Hals stecken bleibt
EoE | Eosinophile Ösophagitis nennt sich die Krankheit, bei der Betroffene nicht mehr schlucken können. Warum dies geschieht, erklären Professor Dr. Alex Straumann, einer der ersten Beschreiber des Krankheitsbildes und Koryphäe auf diesem Gebiet, und der von EoE Betroffene, Christoph Michel, Vorstandsmitglied des Vereins Schweizerische Vereinigung Eosinophile Ösophagitis.
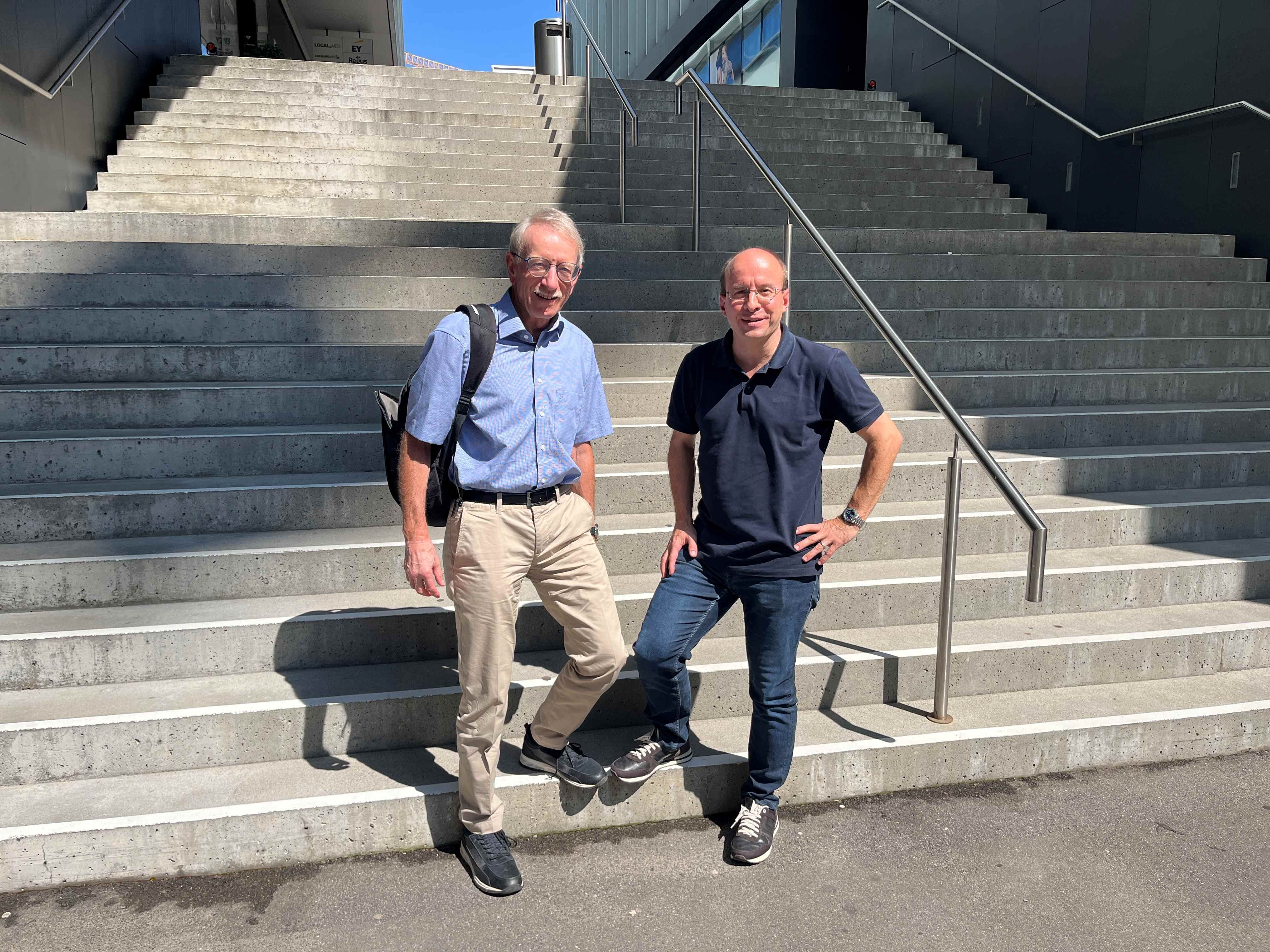
Der zehnjährige Thomas klagte seiner Mutter am Mittagstisch, er könne das Fleisch nicht schlucken. «Du willst nur die Mathearbeit nicht schreiben», konterte diese. Thomas ging in die Schule, schrieb die Arbeit, kam heim – das Fleischstück immer noch im Hals. Wasser, das er trank, kam retour, die eigene Spucke auch. Die Mutter ging zum Hausarzt. Aus dem Zwischenfall wurde ein Notfall. Das war 1989.
Wie ein Zapfen im Flaschenhals
Gastroenterologe Alex Straumann sagt, so etwas habe man zuvor noch nie gesehen: «Die Speiseröhre war nirgends verengt, trotzdem war das Fleischstück eingeklemmt wie ein Zapfen im Flaschenhals.» Mittels einer notfallmässig durchgeführten Endoskopie sei das Nahrungsstück entfernt worden. Zudem habe der Pathologe, der die Abstriche untersuchte, später aufgeregt mitgeteilt, «dass die Speiseröhre-Schleimhaut voller eosinophiler Entzündungszellen war.»
Alex Straumann ist jener Arzt, der sich die Krankheit «Eosinophile Ösophagitis», kurz EoE, zur Lebensaufgabe gemacht hat. Nach Studium und Staatsexamen in Bern machte er den Facharzt an der Uniklinik in Basel. Sein berufliches Ziel war die Forschung, «ausserdem wollte ich mit Menschen in Kontakt sein». Deshalb eröffnete er 1984 in Olten, wo er lebt, seine Praxis für Magendarmkrankheiten. EoE wurde zum Forschungsauftrag: «Es ist eine neue Krankheit, eine, die es damals noch nicht gab.» Deshalb sei sie erst als psychisch abgetan worden. «Da dem kleinen Thomas das Stück Fleisch aber im Wortsinn im Hals stecken blieb, wurde klar, dass die Krankheit organisch ist.» Bis zu diesem Zeitpunkt habe man bei Patienten nur nicht essbare Gegenstände aus der Speiseröhre entfernen müssen, die versehentlich dorthin gelangt seien. «EoE war lange ein Rätsel.» Bei Betroffenen aber zeige sich stets das gleiche Bild: «Sie essen feste Nahrung wie Fleisch, Trockenreis, Karotten oder Gebäck. Die Nahrung rutscht nicht, parkiert kurz, sinkt dann langsam tiefer in die Speiseröhre und in den Magen. Bis der Zeitpunkt kommt, wo ein Lebensmittelstück die Speiseröhre über Stunden ganz verschliesst.»
Schliesslich kamen mehr und mehr Patienten mit ähnlichen Symptomen zu Alex Straumann. Meistens Männer. Und dazu noch gut ausgebildete. Heute ist in Ländern mit westlichem Lebensstil einer von 2500 Menschen von EoE betroffen. «Fakt ist, dass die Krankheit massiv zunimmt.»
Bevor Alex Straumann die Koryphäe auf dem Gebiet wurde, floss viel Wasser die Aare hinunter. Er gab erste Publikationen heraus, beschrieb das Krankheitsbild anhand von zehn Patienten, doch wurde nur wenig gehört. Bis er schliesslich eine Studie veröffentlichte, die beschrieb, wie er 30 Patienten über sieben Jahre beobachtete. Die erste Anerkennung erhielt er von Immunologen: «Plötzlich war die Zeit reif, die Menschen offen, zuzuhören.» Straumanns Arbeit wurde um den ganzen Erdball herum zitiert, er wurde an Spitzenuniversitäten in den USA eingeladen. Bevor der heute 77-jährige, sehr sportliche Arzt seine Oltener Praxis schloss, hatte er 600 EoE-Patienten. Nun ist er noch in einem Teilzeitpensum am Universitätsspital Zürich tätig, wo er die EoE-Sprechsstunde leitet. Er sei immer noch ein «Zabli», schmunzelt Alex Straumann, aber schon ein bisschen müde.
Das Asthma der Speiseröhre
Um herauszufinden, warum manchen Menschen feste Nahrung im Halse stecken bleibt, habe man die Betroffenen mit eiweissfreien Aminosäuren, also Nährlösungen ernährt, wie man es generell bei schweren Allergien mache. «Fast alle waren innerhalb kürzester Zeit beschwerdefrei. Doch sobald die Patienten wieder mit Essen begannen, kamen die Beschwerden zurück.» Aufgrund dessen wisse man heute, dass EoE eine durch Lebensmittelproteine verursachte Allergie sei. Doch sobald die Krankheit erkannt sei, gehe es darum, herauszufinden, welches Nahrungsmittel die Allergie auslöse. Der Weg bis zur richtigen Diagnose sei aufwendig.
Was geschah mit den Lebensmitteln?
Letzlich wisse man nach wie nicht, weshalb die Krankheit entstanden sei. Es gebe zwei Hypothesen. Die erste: «Wir wissen, dass Detergenzien und auch Emulgatoren die Schutzschicht der Speiseröhre zerstören.» Erstere kämen vor allem in Waschmitteln vor. «Die industriellen Geschirrspüler laufen, weil es schnell gehen muss, nur zwischen drei und fünf Minuten. Damit das Geschirr aber sauber wird, braucht es ein Mehrfaches an Spülmittel im Vergleich zu privaten Geschirrspülern. Man untersuchte das Spülwasser und testete im Tierversuch, wie diese sogenannten Barrieren bei den Tieren zerstört wurden.» Man gehe davon aus, dass die industriellen Geschirrspüler für EoE verantwortlich seien. Was erklären würde, so Straumann, dass es vor allem Menschen treffe, die oft auswärts ässen, wie Studenten an der Uni, Menschen im Büro. Zudem: «Auch Emulgatoren, also Konservierungsstoffe, schaden. Diese gibt es nicht nur in der Fertigpizza, sondern auch in manchen Zahnpasten etc.» Das Schockierende: «Diese Stoffe unterstehen keiner Gesetzgebung. Es braucht kein Zulassungsverfahren. Hersteller können Lebensmitteln so viel Konservierungsmittel beifügen, wie sie wollen …» Und dies zerstöre die Schleimhautbarriere der Speiseröhre. Was auch erklärt, weshalb die Krankheit relativ neu ist.
Der Schuss ins eigene Bein
Hypothese 2: Milch und Milcheiweisse. «Es sind die Proteine, welche die Barriere-Funktion zerstören. Nutztiere sind überzüchtet.» Früher habe eine Kuh acht bis zehn Liter Milch gegeben, «heute gibt sie wahrscheinlich über 30 Liter pro Tag, erhält Zusatzfutter etc.» Die Milch sei allergisierender. Resultat der Straumann-Studie: EoE wird in 30 bis 40 Prozent durch Milch ausgelöst. «Viele Patienten, die darauf verzichten, sind EoE-frei.» Schlussfolgerung: EoE wird durch die industrialisierte Lebensmittelproduktion ausgelöst, wie Milch oder Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, etc.). Was bedeutet dies für uns, Herr Straumann? «Alles ist auf maximalen Ertrag ausgerichtet, was wir uns hier einbrocken, ist unglaublich und fällt auf uns zurück.» Weil Alex Straumanns Forschungsthema so brisant ist, erhält er Forschungsgelder und Unterstützung durch den Nationalfonds. «Jetzt geht es noch darum, die Menschheit auf EoE aufmerksam zu machen.» Eine Krankheit, die sich zwischen Lebensmittelproduktion, Ernährungswissenschaften, Gastrologie und Allergologie bewegt. Fazit: «Die gestörte Barriere-Funktion der Speiseröhre ist auf die industrialisierte Lebensmittelproduktion zurückzuführen.»
Warum aber sind zu 75 Prozent Männer betroffen? «Wir sprechen heute von einem Risikogen, das auf dem männlichen Geschlechts-Chromosom sitzt.» Das Risiko der Weitervererbung bestehe, obwohl jemand Träger sein könne, ohne dass die Krankheit ausbreche. Und was lässt sich gegen EoE tun, bis man herausgefunden hat, welches Nahrungsmittel oder Essverhalten es auslöst?
Ambulanz und Medikation
«Es gibt heute Medikamente, die EoE in Schach halten.» Dies seien lokal wirksame Kortison-Präparate, die explizit für EoE-Patienten entwickelt worden seien. Sie wirkten wie Brausetabletten, produzierten Speichel und imprägnierten die Speiseröhre. Das Beste sei, so der Forscher, das Lebensmittel zu finden, das EoE auslöse, und es einfach wegzulassen. Klar sei: «Am häufigsten ist es die Milch, dann der Weizen, dann Eierspeisen und schliesslich Raritäten.» Das Problem: «Dies sind alles Grundnahrungsmittel.» Bei den meisten Betroffenen komme EoE zurück, sobald sie mit der Medikation aufhörten, deshalb sei diese wichtig: «Es geht ums Verhindern gefährlicher Einklemmungen.» Das akute Einklemmen von Nahrung erfordere die Ambulanz. «Je nachdem, wo das Nahrungsmittel eingeklemmt ist, kann es zu Atemnot kommen.» EoE gelte es in jedem Fall sofort zu behandeln. «Eine chronische Entzündung zerstört Struktur und Funktion des befallenen Organs», also hier der Speiseröhre.
Teufelsbrücke, nicht Teufelskreis
Notabene: «Wenn ein Mensch beim Schlucken von geformter, fester Nahrung Beschwerden hat, wenn es harzt, stockenden Kolonnen-Verkehr gibt, eine Wartezeit von drei Sekunden bis zu einer Stunde, bevor die Nahrung rutscht, dann ist immer eine organische Krankheit der Speiseröhre dahinter, nicht der Psyche!» Eine Abklärung sei erforderlich. «Es kann im besten Fall EoE sein, es kann aber auch Speiseröhrenkrebs oder eine andere Störung sein, hat aber nichts mit dem psychisch bedingten Globussyndrom, also den Nerven, zu tun.» Dieses löse eher Schluckzwang aus. «Aber sobald man trinkt, wird es meist besser.» Bei Kindern sei die Abklärung von EoE schwierig. Menschen zwischen 15 und 35 Jahren seien am meisten betroffen. «Es kann aber schon bei einem Zwei-, Dreijährigen losgehen – oder erst mit 80 auftreten.» Viele der Männer seien sehr sportlich, jung, gesund: «Wir wissen noch nicht, warum es gerade diese Gruppe am meisten trifft. Man sieht es niemandem an. Man merkt es höchstens daran, wie langsam jemand isst oder wie er seine Speisen auswählt …»
Der Betroffene
Christoph Michel aus Bönigen ist einer der Betroffenen und setzt sich als Medienverantwortlicher der Schweizerischen Vereinigung Eosinophile Ösophagitis (SVEoE) für Betroffene ein. Der gelernte Polymechaniker, der als Bildungsmanager 20 Jahre lang Kaderkurse – im Bereich der Kommunikations- und Medienarbeit – für die Armee konzipierte und durchführte, arbeitet heute bei der Stadt Bern. Michel ist Leiter Katastrophenmanagement und Stabschef des Regionalen Führungsorgans RFO Bern plus; er liebt die Natur, reist gern und ist im Hunter-Verein Interlaken aktiv. «Ich habe schon als Kind gemerkt, dass ich nicht richtig schlucken kann. Also habe ich mir Strategien zurechtgelegt.» Er ass langsam, trank viel, nahm nur kleine Stücke auf die Gabel. Seit er zwei Jahre alt war, leidet Michel an Asthma bronchiale, musste als Kind ins Sauerstoffzelt, hat Allergien auf Hülsenfrüchte. «Ich kam aber sonst gut durchs Leben.» Bis der Jugendliche bei seinem Götti Linsen angeboten bekam und diese nicht schlucken konnte. Auch bei ihm war es so, dass ihm die Erwachsenen nicht glaubten. «Du willst das nur nicht essen, weil Du es nicht gern hast.» Der Eklat kam immer näher. Bis zum Stück Ragout vor 10 Jahren, das im Hals stecken blieb. Dass dies ein Fall für den Notfall gewesen wäre, wusste er damals noch nicht, ging heim. Es verging nochmals fast ein Tag, bis ihm das Stück Fleisch entfernt werden konnte. Schliesslich zogen von den ersten Symptomen bis zur Diagnose viele Leidensjahre ins Land – bis zur Überweisung zu Gastroenterologe Alex Straumann. Heute ist Michel dank der Medikation beschwerdefrei. «Wahrscheinlich gibt es im Erscheinungsgebiet des ‹Berner Landboten› zig Menschen, die unter diesen Beschwerden leiden, die aber noch gar nicht wissen, dass es dafür einen Namen gibt und man etwas dage-
gen tun kann.»
EoE-Infoabend:
Mittwoch, 27. November, 18.00 Uhr,
Universitätsspital Zürich, grosser Hörsaal Ost
Anmeldung: www.e-oe.ch





