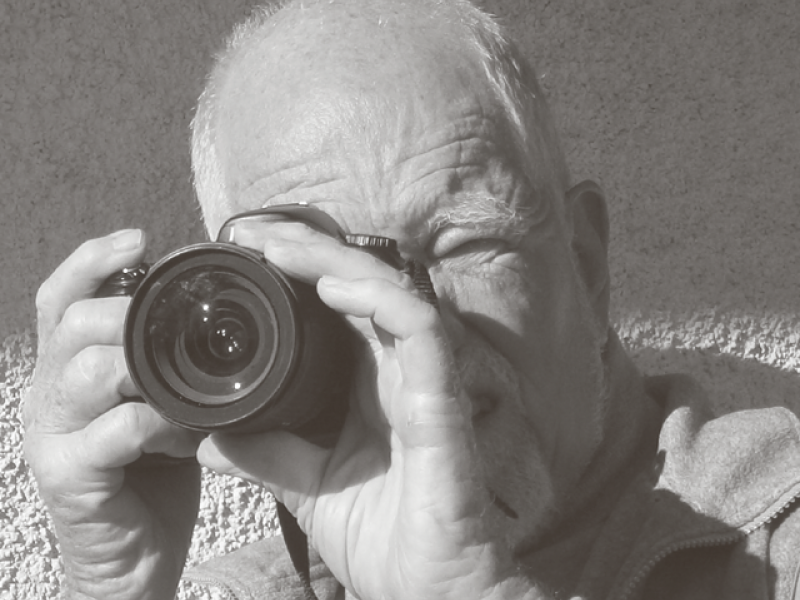Hat die Schweiz wirklich das beste Waldgesetz?
Wald • Katrin Sedlmayer ist Co-Präsidentin IG Wald: Sie kennt sich aus mit dem Wald als Geschenk der Natur. Aber auch mit der Waldbewirtschaftung und deren Konsequenzen. Wir haben sie eingeladen, sich als Gastautorin zum Thema zu äussern.

Überschwemmungen, Steinschläge, Rutschungen und Lawinen machten im 19. Jahrhundert ganze Landstriche in der Schweiz unbewohnbar. Vorausgegangen war eine Übernutzung der Wälder. Holz war der wichtigste Rohstoff und Energieträger für Kohle- und Glasherstellung, fürs Heizen und Bauen.
Nach massiven Überschwemmungen im Tessin und im Kanton Bern 1868 reagierte die Politik. 1876 wurde das erste schweizerische Forstpolizeigesetz in Kraft gesetzt zum Schutze des Waldes. Das revolutionär Neue an jenem Forstpolizeigesetz war der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Dieser legte fest, dass jede Generation Anrecht auf die gleichen Ertragsmöglichkeiten haben soll. Das heisst, dass nur die Zinsen, nämlich das nachwachsende Holz, genutzt werden dürfen. Unangetastet soll aber das Kapital, nämlich der Holzvorrat bleiben. Dieses erste eidgenössische Waldgesetz war und ist noch heute international ein Vorbild. In der Zeit danach vergrösserte sich die Waldfläche. Dank Waldschutz und Wiederaufforstung wurden Gebirgstäler bewohnbar, einst kahle Berge wieder bewaldet. Dadurch gingen die Naturkatastrophen stark zurück.
Fast 150 Jahre sind seither vergangen. Doch wie geht es unseren Wäldern heute? Der Klimawandel mit heissen Sommern und weniger Niederschlägen stresst sie. Dazu kommt der hohe Stickstoffeintrag, verursacht durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr, der in den Waldböden zu einer Versauerung der Böden führt und die Baumarten schwächt. Die Anfälligkeit gegenüber Parasiten steigt, das Baumwachstum wird gehemmt. Vielfalt und Menge der Mykorrhiza-Pilze nehmen ab. Diese aber sind entscheidend für das Wachstum der Bäume und die Kommunikation unter den Bäumen. Als ob das noch nicht genug wäre, schlägt die Holzindustrie seit ein paar Jahren in unseren Wäldern, vor allem im Mittelland, massiv Holz. Denn der Holzschlag rentiert wieder, nehmen doch Schnitzel- und Pelletheizungen stark zu, und Holz wird als nachwachsender Rohstoff und als CO2-neutral propagiert. Gratis leisten unsere Wälder für uns lebenswichtige Dienste: 40 Prozent des Trinkwassers kommt aus den Wäldern. Ein intakter Wald kühlt, erzeugt Regen, speichert Wasser, schützt vor Überschwemmungen, filtert Feinstaub, senkt CO2 und produziert Sauerstoff. Er ist Lebensraum für Millionen von Lebewesen. Für die Menschen ein Gesundmacher: Regelmässige Spaziergänge im Wald wirken sich positiv auf Psyche, Augenlicht, Blutdruck und Herzfrequenz aus und erhöhen die Abwehrkräfte.
Das eidgenössische Waldgesetz soll laut seinem Zweckartikel unter anderem «den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen; dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion erfüllen kann». In den gesetzlichen Bewirtschaftungsgrundsätzen (Art. 20) steht: «Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).» Wandert man aber durch unsere Wälder im Mittelland, sieht man grosse Kahlflächen mit ein paar verwaisten Bäumen, unzählige Schneisen mit tiefen Radspuren. Wie sollen solch stark geschädigte Wälder dem Klimawandel mit steigenden Temperaturen, stärkeren Niederschlägen und vermehrten Stürmen widerstehen; ihre für uns lebenswichtigen Funktionen weiter erfüllen? Wie wirken sich diese massiven Holzschläge mit schweren Maschinen auf den Boden, die Biodiversität, das wertvolle Ökosystem Wald aus? Wie ist das möglich trotz unserem «besten Waldgesetz»? Wie die zwei zitierten Gesetzesvorschriften zeigen, hat das heutige Waldgesetz viele brauchbare Ansatzpunkte. Die aber werden in der Praxis zunehmend verwässert, und wirksame Kontrollen scheinen zu fehlen. Kahlschlag ist laut eidgenössischem Waldgesetz verboten; ebenso sind es Holznutzungsformen, die im Ergebnis einem Kahlschlag nahekommen. Es gibt keine exakte Definition des Kahlschlages, vor allem auch keine konsequente Flächenbegrenzung. «Kahlschlag meint das vollständige Entfernen von Waldbäumen, welches freilandähnliche Bedingungen schafft. Die fragliche Fläche bleibt aber jederzeit, selbst ohne Bäume, Wald im Sinne des Waldgesetzes», führt das zuständige Bundesamt für Umwelt aus. So ergeben sich Schlupflöcher, die zunehmend ausgebeutet werden. Kommt hinzu, dass in der Bundesgesetzgebung selber «Gummi» zur Aushebelung des Kahlschlagverbots angelegt ist: «Für besondere waldbauliche Massnahmen können die Kantone Ausnahmen bewilligen» (Waldgesetz); und noch fataler: «Kein Kahlschlag liegt vor, wenn nach einer ausreichenden und gesicherten Verjüngung nur der alte Bestand geräumt wird» (Waldverordnung). Im Rahmen des «Programme forestier suisse)» von 2004 bis 2015 wurden zudem schleichend Kahlschläge von bis zu 2 Hektaren eingeführt, sofern das Ökosystem Wald «nicht negativ beeinflusst» werde. Zu den waldbaulichen Maßnahmen, die den Kahlschlag rechtfertigen, zählen zum Beispiel: Sicherheitsschläge etwa zum Schutz von Verkehrsanlagen oder als Form der Bewirtschaftung von Wald innerhalb von Hochwasserprofilen, oder die Verjüngung von Lichtbaumarten. All dies wird zunehmend als Vorwand für die Abholzung genutzt, insbesondere die «Verjüngung», um den Wald «widerstandsfähiger» zu machen, obwohl wissenschaftliche Grundlagen dazu fehlen.
Die Auswirkungen der Kahlschläge auf das Ökosystem Wald sind katastrophal. Bis zu 60 Prozent des CO2 ist in den Waldböden gelagert. Schlagen wir den Wald kahl, entweicht dies. Der Boden erhitzt sich, vertrocknet, gewisse Laubbaumarten in der Nachbarschaft erleiden ohne Schatten Sonnenbrand, unzählige Bodenlebewesen werden getötet, der Wasserhaushalt wird gestört. Trotzdem wird munter weiter geholzt.
Sollten wir nicht alles daransetzen, unsere Wälder stark und lebendig zu erhalten? Sind die gepflanzten, angeblich «klimafitten» Bäume wirklich für die Zukunft geeignet? Ein gefährliches Experiment mit ungewissem Ausgang. Die mittleren Temperaturen in der Schweiz haben sich bereits in den letzten 30 Jahren stärker erhöht als in den umliegenden Ländern, und unsere weiteren Kühl- und Wassersysteme, die Gletscher, schmelzen rasant dahin.
Fehler in der heutigen Forstwirtschaft lassen sich nicht schnell und einfach korrigieren, denn Bäume wachsen langsam. Bis wieder Wald auf einer kahlgeschlagenen Fläche steht, dauert es 50 bis 100 Jahre. Falls noch Wald wächst auf den kahlen Böden, verdichtet durch schwere Maschinen, der Sonne, den Starkregenereignissen und Stürmen ungeschützt ausgesetzt. Büssen werden das die kommenden Generationen.